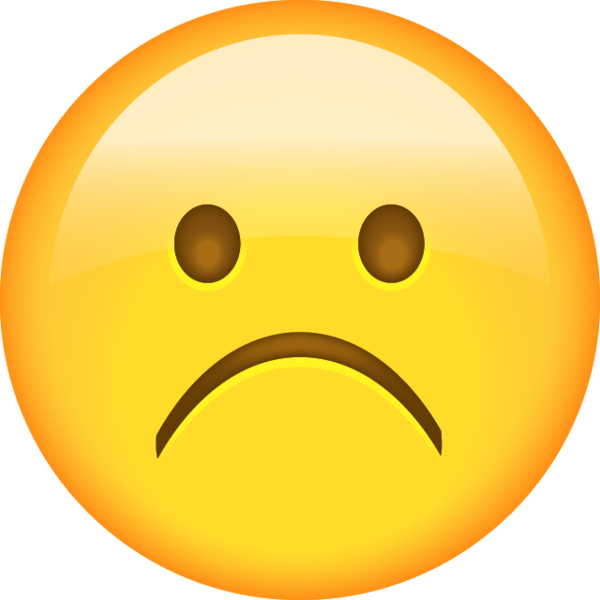Frischmilch-Krieg
Vor 150 Jahren wurde die Frischmilch direkt beim nahe gelegenen Bauern bezogen. Die rasant wachsende Nachfrage in den Städten führte zu neuen Versorgungssystemen, aber bald auch zu Konflikten zwischen den Handelspartnern. Ab 1900 kam es in mehreren deutschen Städten zu den sogenannten Milchkriegen.
Frischmilch ist in den Städten lange kein üblicher Handelsartikel gewesen. Auf dem Bauernhof diente Milch der Jungviehaufzucht. Nur die überschüssige Milch wurde auf dem Hof zu Butter und Käse weiterverarbeitet und lokal verkauft. In den Städten wurde der geringe Bedarf an Frischmilch von Ställen innerhalb des Burgfriedens befriedigt, oder man besorgte sich die benötigten Mengen bei stadtnah gelegenen Bauern. Grundsätzlich war Milch damals ein Getränk für Kleinkinder und zählte nicht zur Alltagskost von Erwachsenen. Nur als medizinisch verordnete Diät, etwa bei Lungentuberkulose, genoss man frische Milch oder Molke. Bis in die 1930er-Jahre galt der Milchgenuss – ähnlich wie der Fleischkonsum – als Zeichen von Wohlhabenheit. Milch, Sahne, Butter und Hartkäse waren Güter, die vom Speisezettel verschwanden, wenn gespart werden musste. Unvorstellbar war der Milchgenuss für Männer. Man wolle kein Milchbart sein, murrte das starke Geschlecht, als die bürgerliche Abstinenzbewegung begann, nach Alternativen für den Alkoholkonsum zu suchen.
Der Genuss von Trinkmilch etablierte sich erst nach 1870 – auf Basis eines ganz neuen Produktions- und Vertriebssystems, bestehend aus Bauern, Molkereien, Milchhändlern und weiterverarbeitender Industrie. Ein Grund dafür lag im Wachstum der Städte. Urbanisierung und Bevölkerungswachstum führten in ganz Europa zu einem Kollaps traditioneller Formen der Nahrungsmittelversorgung. Im Unterschied zu Getreide konnte ein sensibles Naturprodukt wie Milch nicht über weite Strecken transportiert werden. Seiner kommerziellen Nutzung standen Hygiene- und Frischhalteprobleme im Wege. Dennoch entwickelte sich der Handel mit Frischmilch während der Hochphase der Industrialisierung zu einem äusserst lukrativen Geschäft. Kostete 1865 ein Liter Milch in Berlin ungefähr zehn Pfennige, waren es zehn Jahre später bereits ca. 15 Pfennige und zwischen 1880 und dem Ersten Weltkrieg sogar 18 bis 20 Pfennige.
Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts war eine zunehmende Differenzierung im Milchgeschäft bemerkbar: Bäuerinnen oder Milchhökerinnen, die mit ihren Kannen auf den Märkten standen, wurden wegen unlauteren und unhygienischen Verkaufgebarens verdrängt und durch sogenannte Milchniederlagen oder Milchläden ersetzt. Immer öfter lieferten Milchmänner einem festen Kundenstamm die frische Milch per Pferdewagen bis an die Türe. Die Geschäftstüchtigsten unter ihnen gründeten sogenannte Abmelkwirtschaften, die radikalste Form der zunehmend produktorientiert arbeitenden Landwirtschaft. Sobald die Kühe keine Milch mehr gaben, wurden sie durch neue ersetzt. Es wurden weder Butter und Käse produziert noch interessierte man sich für die Nachzucht. Zur gleichen Zeit verdrängte der Landhunger der Industrie die Bauernhöfe an die Peripherie, was nicht nur längere Transportwege zur Folge hatte, sondern auch die Preise für Butter und Käse drückte. Verständlicherweise versuchte jeder Bauer daher, am allgemeinen Frischmilchboom teilzuhaben.
Mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes und der allgemeinen Verbesserung des Transportwesens versuchten auch entfernt liegende Höfe etwas vom Kuchen abzubekommen. Ihre Milch war deutlich billiger. Sollte die Organisation des Transportes gelingen, bestand berechtigte Hoffnung auf gute Geschäfte. Doch das überstieg die Kapazitäten des einzelnen Bauern. Das Einsammeln der frisch gemolkenen Milch und der hygienisch einwandfreie Transport zum Konsumenten bildeten eine logistische Herausforderung. 1879 baute eine bäuerliche Kooperative in München einen Sammelpunkt auf dem Land, so dass die beteiligten Genossenschaftsmitglieder ihre Milch am Zwischenhandel vorbei vermarkten konnten. Dieses Modell wurde sehr erfolgreich. 1894 existierten im Deutschen Reich neben privaten Milchhändlern über tausend bäuerliche Molkereigenossenschaften. Technische Neuerungen trieben die Entwicklung voran: Der schwedische Ingenieur Gustav de Laval baute Milchzentrifugen, mit denen die Entrahmung der Milch beschleunigt und somit die Konflikte um die unverkaufte Milch entschärft werden konnten. Verständlicherweise wollten die Landwirte die gesamte Tagesproduktion verkaufen, Milchhändler und Molkereien dagegen unverkaufte Mengen wieder zurückliefern.
Zwischen 1890 und 1910 wurde im Deutschen Kaiserreich ein dramatischer Anstieg der Bahnmilch beobachtet. In Dresden etwa waren 1886 ca. sieben Millionen Liter angeliefert worden, 1895 waren es bereits ca. 20 Millionen Liter, und bis 1910 verdoppelte sich die Zahl noch einmal auf ca. 40 Millionen Liter. Man schätzt, dass ungefähr dieselbe Menge zusätzlich per Pferdefuhrwerk in die Stadt gebracht wurde. Wie ein Spinnennetz breitete sich der Güterverkehr rund um die Grossstädte aus, und immer weiter reichten die Fäden des Netzes. Mit der Grösse der Stadt wuchs die Distanz zum Milchproduzenten. Nürnberg und München kalkulierten 1904, dass rund 26,3 Prozent der verkauften Frischmilch aus einer Distanz von 50 bis 99 Kilometer in die Stadt transportiert wurde.
Die Verkehrszunahme führte zu gravierenden Problemen in der Eisenbahnlogistik. Während kleine Eilgüterzüge die durch Isolierungen kalt gehaltenen Milchkannen rechtzeitig zum Bestimmungsort brachten, benötigte man dort effiziente, wendige und kostengünstige Lastkraftwagen für den Weitertransport. Milchfuhrunternehmen entstanden; eines der grössten war die Meierei Bolle in Berlin. 1890 betrieb sie 116 Milchwagen, die mehr als 3.000 Stellen anfuhren. 1891 hatte die Firma 700 Beschäftigte, neun Jahre später waren es 2000.
Der überhitzte Milchmarkt geriet aus den Fugen und konnte zu Engpässen in der Fleischproduktion führen. Es war ein Teufelskreis: Weil die Herstellung von haltbareren Molkereiprodukten weniger rentabel war, fand ein Run auf den Frischmilchmarkt statt. Weil die Frischmilchproduktion die Nachfrage weit überstieg und grosse Mengen unverkaufter Milch an die Molkereien zurückging, investierten diese in die Diversifizierung des Sortiments. Die Produktpalette weitete sich aus, die Spezialisierung auf Seiten der Produzenten nahm zu. Alles zusammen destabilisierte den städtischen Milchmarkt. Grosse Milchverarbeiter wurden zunehmend unabhängig von den Bauern. Die Kleinhändler, die Kontrakte mit Bauern der Umgebung hatten, hielten sich gegen deren Vormachtstellung nur durch Preisdumping über Wasser. Die Verluste gaben sie an die Bauern weiter, die wiederum den Verkauf nur noch in eigenen Genossenschaften förderten. Jeder kämpfte gegen jeden, und am Ende waren alle Branchen heftig zerstritten. Im Jahr 1900 tauchte erstmals der Begriff «Milchkrieg» in der Presse auf. Zwischen 1914 und dem Ersten Weltkrieg erlebten viele Städte, zum Beispiel Hamburg, Hannover, Dresden, Düsseldorf oder München, solche Milchkriege.
Got Milk?
Seit dem Ende des 2. Weltkrieges ist der Milchkonsum in den USA stetig gesunken. Also startete 1993 die kalifornische Milchwirtschaft eine gemeinsame Werbekampagne, um den Milchkonsum anzukurbeln. „Got Milk ?“ (Haste Milch ?) wurde zu einer der traditionellsten, klassischsten Werbekampagnen der Welt.